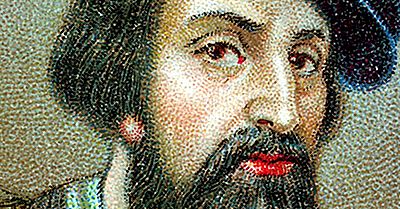Was ist Mercantilismus?
Merkantilismus ist eine Wirtschaftstheorie, die in Westeuropa zwischen 1500 und 1700 üblich ist. Es basierte auf der Idee, dass die Welt eine endliche Menge an Reichtum hat. Unter dem Merkantilismus regierten die Regierungen die Volkswirtschaft, um möglichst viel dieses verfügbaren Reichtums zu erwerben und in Währungsreserven zu speichern. Zu dieser Zeit glaubte man, dass der Erfolg und die Macht eines Landes an seinen Goldreserven gemessen werden könnten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ein Schwerpunkt auf die Begrenzung der Einfuhren und die Erhöhung der Exporte gelegt, um eine positive Handelsbilanz zu schaffen.
Grundsätze des Merkantilismus
Der Merkantilismus hat mehrere Grundprinzipien, die wahr waren, egal wo sie praktiziert wurden. Diese beinhalten:
- Die Regierungen setzten hohe Einfuhrzölle ein, um Waren, die in das Land eingeführt wurden, abzuschrecken, und stellten Subventionen für Exporte bereit, um eine erhöhte Anzahl von Waren zu fördern, die das Land verlassen.
- Silber und Gold konnten nicht exportiert werden.
- Handelsgüter konnten nicht auf ausländischen Booten transportiert werden.
- Wenn das Land Kolonien besitze, könnten diese Kolonien nicht mit fremden Ländern Handel treiben.
- Um Produkte für den Export zu haben, unterstützten die Regierungen die verarbeitende Industrie durch Steuererleichterungen und Subventionen. Darüber hinaus wurde die Verwendung lokaler Ressourcen für die Produktion als ideal angesehen.
Vor dem Merkantilismus praktizierten die meisten Länder Westeuropas feudale Ökonomien. Für diese Länder war der Merkantilismus das erste Mal, dass die Regierung die Wirtschaftstätigkeit regulierte und kontrollierte.
England und Frankreich: Zentren des Merkantilismus
Frankreich hat als erstes europäisches Land merkantilistische Maßnahmen ergriffen. In 1539 verbot die Monarchie den Import von Wolle aus Spanien und im folgenden Jahr verbot der Export von Gold. Dies war der Beginn des Merkantilismus in Frankreich und im weiteren Verlauf des X. Jahrhunderts führte er mehr von dieser Wirtschaftspolitik ein. Die Regierung regulierte sogar die Herstellung und definierte, wie bestimmte Produkte hergestellt werden sollten. Dieses Land hat in seinen Kolonien in Nordamerika die gleiche Politik umgesetzt.
Der Mercantilismus war in England um 1640 am stärksten, obwohl monopolisierte Unternehmen von vielen negativ bewertet wurden. Die britische Krone initiierte auch merkantilistischen Handel mit seinen amerikanischen Kolonien. Insbesondere wurden zwei politische Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass Kolonisten britische Waren statt ausländischer Waren kaufen würden: das Zuckergesetz und die Navigationsgesetze. Das Sugar Act erhöhte die Zölle auf Zucker und Melasse aus anderen Ländern und zwang die Kolonisten dazu, von Großbritannien zu kaufen. Die Navigationsgesetze verboten den Außenhandel entlang der amerikanischen Küste und forderten, dass die kolonialen Exporte zunächst vom britischen Zoll überprüft wurden. Diese Steuern und Beschränkungen waren bei den Kolonisten nicht beliebt und führten schließlich zum Unabhängigkeitskrieg.
Kritik des Merkantilismus
Kritiker des Merkantilismus behaupten, dass dieser ökonomische Ansatz das globale Wirtschaftswachstum tatsächlich behindert habe. Dies liegt daran, dass die Unternehmen eher motiviert waren, sich auf die Produktion von Waren und Dienstleistungen zu spezialisieren. Wenn beispielsweise ein bestimmter Import verboten ist, werden die Hersteller daran arbeiten, dieses Produkt im Inland zu produzieren. Dies führt jedoch normalerweise zu einer ineffizienten Produktion oder zu höheren Investitionskosten. Dies wiederum erhöht die Endverbraucherkosten des Produkts und senkt den potenziellen Gewinn. Das Land mit Handelsbeschränkungen verringert sein potenzielles Wirtschaftswachstum. Darüber hinaus hat das Land, das ein Produkt effizient und kosteneffektiv herstellen kann, keine Chance. Dies verringert auch das potenzielle Wirtschaftswachstum im anderen Land. Mercantilism erlaubt keinen gegenseitigen Nutzen, der den globalen Markt negativ beeinflusst.